Der neuentwickelte "De-Jargonizer" markiert Forschern in ihren Texten Ausdrücke, die im alltäglichen Sprachgebrauch nicht üblich und deshalb schwer verständlich sind. Wissenschaftler sollen dadurch wissen, welcher Jargon für Laien fremd ist. [...]
Entwickelt wurde die „De-Jargonizer“-App von Technion, dem israelischen Institut für Technologie und dem HIT, Holon Institut für Technologie.
Online-News durchsucht
Die kostenlose Software identifiziert automatisch Begriffe, die eine durchschnittliche Person ohne wissenschaftlichen Bezug nicht verstehen würde. Sobald ein Text hochgeladen oder eingefügt wurde, markiert ein Algorithmus die ungebräuchlichen Wörter je nach Häufigkeit der Verwendung in Orange oder Rot. Auch die Angemessenheit für die Öffentlichkeit wird von null bis 100 geschätzt und Wörter werden gezählt.
Möglich ist das durch einen Algorithmus, der sprachlich informelle Online-Nachrichten durchsucht. Danach eruiert das System, ob das gewünschte Wort oft verwendet wurde. Wörter können als häufig verwendetes, allgemeines oder Jargon-Vokabular eingestuft werden – je nach Häufigkeit der Erwähnung in Online-Medien. Der Korpus wird regelmäßig aktualisiert und lässt sich um andere Quellen oder Sprachen erweitern.
Ausgrenzung durch Sprache
„Der De-Jargonizer gibt einen groben Einblick in die Häufigkeit der Verwendung von Jargon beim wissenschaftlichen Schreiben“, sagt Ayelet Baram-Tsabari, Professorin am Technion. Das Programm zeigt, dass Laienberichte nur zehn Prozent Jargon beinhalten und akademische Zusammenfassungen 14. Für ein adäquates Verständnis muss der Leser mit 98 Prozent der Wörter vertraut sein. Das heißt: Die Anzahl der unbekannten Wörter, wie zum Beispiel Fachwörter und Jargon, dürfen nur weniger als zwei Prozent des Textes betragen – viel weniger als in einem durchschnittlichen Laienbericht.
„Wissenschaftler wissen zwar, dass sie gegenüber der Öffentlichkeit weniger Fachwörter verwenden sollen als ihren Kollegen gegenüber. Trotzdem werden durch die Verwendung so vieler fremder Wörter gerade die Menschen ausgegrenzt, die sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen“, beklagt Baram-Tsabari. Das Programm wurde entwickelt, um Forscher und Wissenschaftskommunikatoren dabei zu helfen, ihre Sprache an den Gebrauch gegenüber Nicht-Experten anzupassen. Das langfristige Ziel ist, Wissenschaft für die breite Masse verständlich zu machen.




!["Sammlung allerhand auserlesener Reponsorum […]", Johann Hieronymus Hermann, 1736 (c) Österreichische Nationalbibliothek](https://d020f13e.delivery.rocketcdn.me/wp-content/uploads/Kulturpool_Digitalisat_ONB-326x245.jpg)


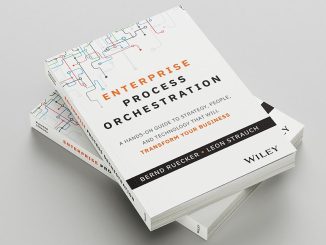


Be the first to comment