Die Mathematik befreit Gebäudedesign von althergebrachten Formen und ermöglicht die Umsetzung spektakulärer Bauideen, wie ein Projekt des Wissenschaftsfonds FWF beweist. [...]
Spätestens das Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao zeigte es eindrucksvoll: Gebäudestrukturen können sich vom Korsett einer traditionellen Formensprache lösen. Verantwortlich dafür sind entsprechende Computerprogramme, die kreative Ideen der Architektinnen und Architekten in packende Visualisierungen umsetzen. Die daraus entstandene Disziplin der Freiformarchitektur steht noch am Anfang. An der Technischen Universität Wien leisten nun Grundlagenforscherinnen und -forscher in einem FWF-Projekt wichtige Beiträge zur Entwicklung einer der aktuell spannendsten Sparten der Architektur.
FORM FOLGT FORSCHUNG
Tatsächlich wirft der Trend zu Freiformstrukturen in der zeitgenössischen Architektur zahlreiche anspruchsvolle Forschungsprobleme auf. Einige davon können mithilfe der Differentialgeometrie – einer Disziplin der Mathematik – gelöst werden, wie Projektleiter Helmut Pottmann, Professor und Leiter des Center for Geometry and Computational Design an der Technischen Universität Wien, erläutert: „Aus Kosten- und Planungsgründen muss selbst die kreativste Freiform aus möglichst einfachen und einheitlichen Bauteilen zusammengesetzt werden. Dies zu planen ist ein klarer Fall für die diskrete Differentialgeometrie. In dieser werden Kurven und Flächen diskretisiert, also rechnerisch in einfache, ebene Elemente zerlegt. Das reduziert die zu berechnenden Variablen drastisch.“ Dabei können die als Paneele bezeichneten Zerlegungen so gewählt werden, dass sie auch bestimmte Anforderungen an die Ästhetik oder die Bauphysik erfüllen. Visualisiert man eine solche Zerlegung, erscheint diese wie ein engmaschig gewobenes Gewebe, das als Modellrechnung über jede erdenkliche Form gezogen werden kann.
VERNETZTE FORSCHUNG
Die mathematische Repräsentation solcher Netze ist der Forschungsschwerpunkt von Pottmann und seinem Team. Im Rahmen des Projekts gelangen der Gruppe gleich mehrere Fortschritte. So konnte die Berechnung diskreter Flächen um sogenannte hyperboloide Oberflächenteile erweitert werden, die es erlauben, glatte Freiform-Flächen, wie beispielsweise Fassaden, aus einfachen Paneelen zu erschaffen. Auch gelang es, ein interaktives Designtool zu entwickeln, das Gleichgewichtskräfte an den Kanten diskreter Flächen berechnen kann. Zudem konnte das Team auch noch ein Tool entwickeln, das Gleichgewichtskräfte in Schalen exakt berücksichtigen kann. Das war vorher nur näherungsweise, eingeschränkt oder auf sehr zeitintensive Weise möglich. Die interaktiven Möglichkeiten dieses Tools wurden bereits in weiteren Architekturanwendungen integriert. Ein schöner Beleg für die hohe Praxistauglichkeit der entwickelten Berechnungsmodelle.
FORSCHUNG ALS FUNDAMENT
Überhaupt ist die Anwendung der zunächst rein mathematischen Weiterentwicklungen immer im Fokus von Pottmann, der auf ganz konkrete Probleme in der Freiformarchitektur hinweist: „Bei Stahl-Glas-Konstruktionen ist es sehr wünschenswert, dass die Stahlträger an einem Knotenpunkt nicht beliebig sondern geordnet zusammenstoßen. Das klingt simpel – ist aber alles andere als einfach zu planen, wenn die Architektur einer frei fließenden Form folgt. Unsere Forschung hilft genau solche Probleme zu lösen.“
In der Tat fehlt es vielen Programmen, die für Designentwicklungen verwendet werden, an der Berücksichtigung spezieller bauphysikalischer Notwendigkeiten. Denn viele von ihnen basieren auf Grundlagen der Massenproduktion, in der sich ganz andere Herstellungsmethoden rentieren als für architektonische Unikate. So müssen praxistaugliche Programme für die Freiformarchitektur die Aufteilung von Formen in Paneele genauso erlauben wie die Auslegung einer Unterkonstruktion und die Berücksichtigung der Eigenschaften verschiedener Baumaterialien – und all das für spezifische geometrische Probleme. Dabei sollte nach Einberechnung all dieser Faktoren die ursprünglich gewünschte Form möglichst getreu wiedergegeben werden.
Derzeit sind die mathematischen Antworten auf diese architektonischen Herausforderungen noch nicht alle gefunden. Doch die Arbeiten von Pottmann und seinem Team sollen ein solides Fundament für die zukünftige Kreativität von Architektinnen und Architekten legen. (pi/rnf)



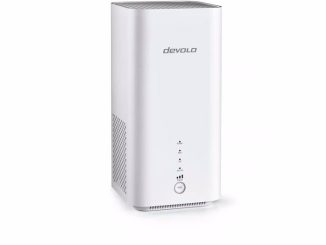






Be the first to comment