Viele Jahre lang war der charismatische Steve Jobs der unbestrittene Star der Produktankündigungen von Apple. Wir blicken auf die Tricks und Geheimnisse beim Präsentieren des 2011 verstorbenen Apple-Chefs zurück. [...]
Wer glaubt, Steve Jobs hätte sich bei seinen Präsentationen allein auf sein Charisma verlassen, der täuscht sich. Carmine Gallo schreibt, dass sich Jobs immer akribisch auf seine Präsentationen vorbereitet hat. Ob man nun wie Jobs Stift und Papier dafür verwendet, ist Geschmackssache. Wichtig zu wissen ist aber, dass Jobs seine Präsentationen wie Spielfilme plante: mit einer packenden Geschichte, die keine Zeit für Ablenkungen bietet, mit Helden und Bösewichten sowie mit Spezialeffekten und Überraschungen. „Zuerst kam immer die Geschichte. Die Folien waren nur zur Ergänzung gedacht“, heißt es dazu bei Gallo.
Als Jobs im Januar 2008 das MacBook Air vorstellte, war es für ihn schlicht „das dünnste Notebook der Welt“. Solche Botschaften lassen sich leicht verbreiten. Laut Gallo hat Steve Jobs für jedes Produkt seines Unternehmens eine Beschreibung gefunden, die sich auf einen einzigen Satz beschränkt. Diese knappen Zusammenfassungen machen es dem Publikum leicht, die Botschaften des Herrn in nur 140 Zeichen via Twitter in die Welt zu tragen. Aber man täusche sich nicht: Solche Botschaften zu verkünden geht schnell, sie zu schreiben, braucht viel Zeit.
Jeder gute Film-Plot braucht neben dem Helden auch einen Bösewicht. Am Anfang der Apple-Geschichte war das IBM, von Jobs in einem berühmten Spot dämonisiert. „Laut dem Markenexperten Martin Lindstrom haben große Marken und Religionen etwas gemeinsam“, schreibt Gallo, „nämlich die Idee, einen gemeinsamen Feind zu besiegen“. Jobs habe in dem Werbespot einen Bösewicht geschaffen, „der es den Zuhörern ermöglichte, sich um den Helden zu scharen“, um Apple und seine Produkte. Heutzutage muss das Böse nicht mehr unbedingt personalisiert sein. Auch ein Problem braucht mitunter Helden, um gelöst zu werden. „Als Jobs im Januar 2007 das iPhone vorstellte, konzentrierte sich seine Präsentation auf die Probleme, die Mobilfunknutzer mit dem damaligen Stand der Technik hatten. Das iPhone, so sagte er, werde diese Probleme lösen.“ So einfach kann es auch sein.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber von Steve Jobs perfektioniert: Rede nicht über das Produkt und seine technischen Fähigkeiten, sondern über den Nutzen und die Vorzüge eines Produktes. Jobs, schreibt Gallo, habe seinen Kunden diese Verbindung immer klar gemacht. Wer die Frage „Was habe ich davon?“ aus der Sicht seiner Kunden kurz und prägnant beantworten kann, macht es richtig. „Top-Ten-Listen“ oder „10 Gründe, warum X Ihren Alltag verschönern wird“ sind mögliche Ansatzpunkte für eigenes Marketing.
Die Drei ist eine magische Zahl: „Drei Dinge braucht der Mann“, „drei Kreuze machen“ oder „drei Wünsche frei“ – auch durch die Präsentationen von Steve Jobs zog sich die Drei wie ein roter Faden. Gallo verweist etwa auf eine Vorführung von Jobs im Jahr 2009, wo er drei Produkte präsentierte: das iPhone, iTunes und den iPod. „Die Zahl Drei ist ein leistungsfähiges Konzept beim Schreiben“, weiß Gallo. „Dramatiker wissen, dass die Drei dramatischer ist als die Zwei; Komiker wissen, dass die Drei witziger ist als die Vier; und Steve Jobs wusste, dass Drei leichter zu merken ist als Sechs oder Acht.“
Wer Steve Jobs als das bezeichnet, was er im Grunde genommen war, wird ihm dennoch nicht gerecht: „Er verkaufte keine Computer – er verkaufte das Versprechen einer besseren Welt“, heißt es dazu bei Gallo. Nicht mehr, aber auf keinen Fall weniger. „Leidenschaft, Enthusiasmus und Zielstrebigkeit in Bezug auf das eigentliche Produkt und darüber hinaus machten den Unterschied aus, der Jobs und Apple auszeichnete.“
Steve Jobs hatte offenbar gute Powerpoint-Vorlagen, denn jede Präsentation folgte demselben Muster, wie Gallo schreibt: Es gab keine der weithin gefürchteten Aufzählungspunkte, stattdessen viele Fotos und Bilder. Und anstelle der durchschnittlichen 40 Wörter pro Folie gab es bei Jobs nur sieben. Die Technik dahinter („ein Bild sagt mehr als tausen Worte“) heißt „Picture Superiority“ und steht jeder Präsentation gut zu Gesicht.
Große Zahlen erschließen sich Zuhörern nicht immer sofort. So steht die Zahl von 220 Millionen verkaufter iPods, die Apple-Vize Phil Schiller 2009 nannte, relativ einsam da. Erst wenn man Zahlen in Relation setzt, werden sie verständlich. 220 Millionen – das entsprach damals einem Marktanteil von 73 Prozent. Oder, noch anschaulicher: Drei von vier MP3-Player waren von Apple. Und Microsoft – mit Zune damals auch bei den MP3-Playern ein großer Konkurrent von Apple? Mit einem Prozent lag der Konzern ganz am Ende der Rangliste. Solche Vergleiche versteht jeder. Der Gallo’sche Merksatz dahinter lautet: „Je größer die Zahl, desto wichtiger ist es, Analogien oder Vergleiche zu finden, welche die Daten für die Zuhörer relevant machen.“
Klartext ist besser als politisch korrekte, aber langweilige Begriffe. Steve Jobs sprach einmal davon, dass das iPhone 3G „erstaunlich flott“ sei. Das sagt nicht wirklich viel aus, kommt bei den Zuhörern aber an, weil es nahe am normalen Sprachgebrauch ist. Wörter wie „Spitzenprodukt“ oder „Synergie“ aus dem Satzbaukoffer von Marketingexperten hat Jobs dagegen selten bis nie verwendet. „Seine Sprache war einfach, klar und direkt“, heißt es dazu bei Gallo. Und das ist nun einfach immer richtig.
Kurze Sätze, anschauliche Wortwahl: Damit schaffte es Jobs, seinen Zuhörer Botschaften zu übermitteln, die diese auch verstanden haben, um sie direkt anschließend in die Welt hinaus zu posaunen. Aber ohne die am Anfang erwähnten Spezialeffekte ging es auch bei Jobs nicht ab. „Jede Präsentation von Steve Jobs hatte einen Moment, den Neurowissenschaftler als ‚emotionsgeladenes Ereignis‘ bezeichnen“, so Carmine Gallo. Es ist ein Moment, der den Zuhörern signalisiert: „Merk dir das jetzt!“ Ein Beispiel: Auf der Macworld 2007 sprach Jobs von „drei revolutionären Produkten“: ein Breitbild-iPod mit Touchscreen, ein Mobiltelefon und ein Internet-Kommunikationsgerät. Und das emotionsgeladene Ereignis? „Das sind nicht drei verschiedene Geräte“, so Jobs damals. „Das ist ein und dasselbe Gerät!“ Die Zuhörer brachen in Beifallsstürme aus, schreibt Gallo, weil diese Auflösung so unerwartet und unterhaltsam war.
Wer sich, wie Carmine Gallo, Präsentationen von Jobs über einen längeren Zeitraum bei Youtube angeschaut hat, wird feststellen, „dass er sich mit jedem Jahrzehnt erheblich gesteigert hat“. Niemand werde mit dem Wissen geboren, wie man Folien großartig präsentiert. Kompetente Redner verfeinern diese Fähigkeit durch Übung. Das hat auch Steve Jobs so gemacht, der sich überdies für jede seiner großen Vorführungen viel Zeit genommen hat: „Ja, Jobs ließ seine Präsentationen locker aussehen, aber dieser Glanz war das Ergebnis stundenlanger, anstrengender Übung.








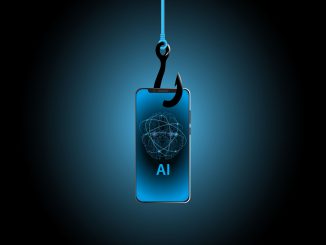

Be the first to comment