Physiker am Atominstitut der TU Wien bestätigen eine Unschärferelation beim Informationsaustausch zwischen zwei Quantenmessungen. Das hat hohe Bedeutung für die Quanten-IT. [...]
Information ist eine Kerngröße in der Wissenschaft und spielt eine bedeutende Rolle in vielen Wirtschaftszweigen wie der Kommunikationstechnologie, der Kryptographie oder der Datenspeicherung. Auch in der Quantenkommunikations und -informationstechnologie erforscht man die Übertragung und Verschlüsselung von Informationen, wo jedoch entsprechende Quantenphänomene wie die Unschärferelation mitberücksichtigt werden müssen. Experimente an der TU Wien in Zusammenarbeit mit Theoretikern aus Australien und Japan werfen nun einen neueren, genaueren Blick auf die Unschärferelation im Bezug zur Informationstheorie. Grundlagen der Quantenphysik konnten mit den Erkenntnissen aus der Informationstheorie beschrieben werden.
Heisenbergs Unschärferelation ist eine der fundamentalsten Aussagen der Quantenphysik. Sie sagt, dass bestimmte Eigenschaften von Quantenteilchen, etwa Ort und Impuls, nicht gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit bestimmt werden können. Ein Teilchen kann sich an unterschiedlichen Orten gleichzeitig aufhalten und unterschiedliche Geschwindigkeiten gleichzeitig annehmen. Die Frage, wo und wie schnell sich das Teilchen nun „wirklich“ bewegt, ist sinnlos – die Natur enthält einfach keine Information darüber – man könnte sagen, das Teilchen weiß es selbst nicht. Historisch wurde die Unschärferelation allerdings durch Bezug auf ein Mikroskop-Gedankenexperimente erklärt: Jede Messung hat zwangsläufig einen Einfluss auf das gemessene Objekt. Wenn man beispielsweise den Aufenthaltsort eines Elektrons mit Hilfe von Lichtwellen sehr genau messen will, dann muss man dazu sehr kurze Lichtwellen verwenden. Kurzwelliges Licht hat allerdings sehr viel Energie, wodurch der Impuls des Teilchens stark verändert wird. Je genauer man den Ort messen möchte, umso stärker stört man durch das Experiment den Impuls. „Unglücklicherweise werden diese beiden Darstellungen der Unschärferelation im physikalischen Alltag, aber auch in Lehrbüchern, oft miteinander verwechselt, obwohl sie vollkommen verschiedene physikalische Umstände beschreiben“, sagt Stephan Sponar vom Atominstitut der TU Wien.
Letztes Jahr haben Physiker in Australien und Japan mithilfe der sogenannten Entropie die Unschärfe zwischen „Informationsgehalt“ und „Vorhersagbarkeit“ genauer analysiert und eine trade-off Relation aufgestellt. Diese Konzepte spielen eine zentrale Rolle in der Kommunikationstheorie, den Ingenieurwissenschaften und der Informatik. „Daher ist es vollkommen natürlich, eine Formulierung der Heisenbergschen Unschärferelation zu finden, die auf Grundlagen der Informationstheorie beruht“, sagt Bülent Demirel, ebefalls vom Atominstitut der TU Wien.
Bei den Forschungen rund um Prof. Hasegawa von der TU Wien wurde diese neue Theorie mittels neutronenoptischer Methode am Forschungsreaktor am Atominstitut Wien getestet. Für das Experiment wurde der Spin von Neutronen, wie sie bei der Kernspaltung produziert werden, durch aufeinander folgende Messungen bestimmt. Anders als in der klassischen Informatik, wo klassische Bits nur die Werte 0 oder 1 haben können, kann der Spin ein sogenanntes Quantenbit (qubits) an Informationen darstellen. Für Spin-Messungen gilt eine Unschärferelation, genau wie für Ort und Impuls. Man kann nicht gleichzeitig den Spin in X-Richtung und in Y-Richtung präzise messen. Somit kann man die Neutronenspins als Träger des qubits ansehen und damit die informations-theoretische Unschärferelation testen.
Es gelang, eine reziproke Relation für Informationsgehalt und Vorhersagbarkeit herzuleiten. Je höher der Informationsgehalt durch die Messung des qubits erworben wurde, umso geringer war die Vorhersagbarkeit dessen, wie der Wert zustande gekommen ist und umgekehrt. Zwischen Informationsgehalt und Vorhersagbarkeit bildet sich ein verbotener Bereich aus, welcher ausdrückt, dass Information nicht gleichzeitig durch beide Messungen beliebig genau gewonnen werden kann. Desweitern wurden Protokolle zur Quanten-Fehlerkorrektur angewandt, um zu ermitteln, wie viel Information reversibel ist und daher erhalten werden kann, und wie viel Information durch Messung unweigerlich zerstört wird. Die Richtigkeit der postulierten Relation zwischen Informationsgehalt und Vorhersagbarkeit konnte mit höchster Präzision eindeutig nachgewiesen werden. Diese Formulierung wird vom Forschungsteam nun im Fachjournal „Physical Review Letters“ präsentiert und ist als „Editor’s Suggestion“ auserkoren worden.
Die neuen Ergebnisse quantifizieren die Grenzen der Übertragung von Information über Quantenkanäle und haben somit eine hohe Bedeutung in weiten Bereichen der Quanteninformationstechnologie. Verrauschte Kanäle, Informationsverlust entlang von Leitungen, aber auch die Quantenverschlüsselung von Daten können somit besser verstanden werden. (pi)


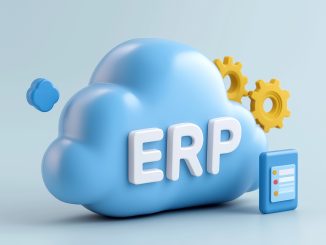







Be the first to comment